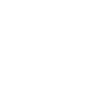Als im Frühling 1947 die Abiturprüfungen anstanden, war das Land ein völlig anderes als noch zehn Jahre zuvor. Zwar war Schwarzenberg von Kampfhandlungen weitgehend verschont geblieben, dennoch waren die Auswirkungen von Krieg und Neubeginn auf die Oberschule der Stadt gravierend. Der langjährige Schulleiter Dr. Fröbe, der wie die meisten seiner Kollegen entlassen und durch den 1933 seines Amtes enthobenen Dr. Knopf ersetzt worden war, lebte nicht mehr, das Schulhaus an der Bermsgrüner Straße stand als Wismut-Objekt bis auf Weiteres nicht mehr für den Unterricht zur Verfügung und das Schulwesen in der sowjetischen Besatzungszone war mit dem „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schulen“ 1946 grundlegend reformiert worden.
Allen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen zum Trotz hatte im Oktober 1945 mit den verbliebenen Schülerinnen und Schülern auch in Schwarzenberg der Unterricht wieder begonnen und im Jahr darauf der erste Nachkriegsjahrgang seine Hochschulreife erhalten. Das Schuljahr 1946/47 war zum ersten Mal wieder zum regulären Zeitpunkt angelaufen und das erste, das auf Grundlage des neuen Schulgesetzes durchgeführt wurde.
Vorbereitungen
Anders als heute wurden alle Themen und Aufgaben der Reifeprüfung von der Schule selbst festgelegt. An der ersten Sitzung des Reifeprüfungsausschusses nahmen Teil:
- Oberstudienrat Dr. Karl Knopf, 1933 als Lehrer entlassen und nach Exil in Dänemark und Schweden 1946 als Schulleiter zurückgekehrt,
- Dr. Richard Truckenbrodt, seit 1924 Lehrer im Wartestand, zwischenzeitlich Hotelier in Johanngeorgenstadt und nach dem Krieg neu angestellt,
- Studienrat Hermann Hallbauer, der als politisch Unbelasteter aus dem alten Kollegium übernommen worden war,
- Prof. Alfred Jaronczyk, der 1944 mit einer Klasse aus dem heute im Süden Polens gelegenen Neu Sandez nach Schwarzenberg gekommen war,
- Neulehrer Hermann Seidel,
- Neulehrer Gerhard Kunze und
- Neulehrerin Käthe Sasse.
Zum Prüfungsausschuss gehöhrte außerdem der an diesem Tag nicht anwesende Neulehrer Horst Möhle. Gemeinsam legte das in Alter und Berufserfahrung äußerst heterogene Gremium einen dicht gedrängten Plan für die schriftlichen Prüfungen fest:
- Freitag, 11. April 1947: Englisch, 3 Stunden, Frau Sasse (Zweitkorrektor: Herr Möhle)
- Sonnabend, 12. April 1947: Mathematik, 5 Stunden, Herr Seidel (Zweitkorrektor: Dr. Knopf)
- Montag, 14. April 1947: Deutsch, 5 ½ Stunden, Herr Hallbauer (Zweitkorrektor: Dr. Truckenbrodt)
- Dienstag, 15. April 1947: Chemie, 3 Stunden, Herr Kunze (Zweitkorrektor: Herr Seidel)
Die mündlichen Prüfungen wurden in zwei Gruppen innerhalb eines Tages abgenommen, nämlich in Abteilung A am Mittwoch, dem 23. April, und in Abteilung B am darauffolgenden Donnerstag. Insgesamt traten 20 Schüler, 2 Schülerinnen, eine Hospitantin und ein Schulfremder zur Prüfung an. Der Plan sah an beiden Tagen die folgenden Zeiten vor:
- 08:00-09:00 Uhr: Mathematik, Herr Seidel
- 09:20-10:20 Uhr: Geschichte, Dr. Truckenbrodt
- 10:40-11:40 Uhr: Deutsch, Herr Hallbauer
- 15:00-16:00 Uhr: Latein, Dr. Truckenbrodt
- 16:20-17:20 Uhr: Biologie, Herr Kunze
Die schriftlichen Prüfungen
Der Ablauf der schriftlichen Prüfungen wich kaum von dem der heutigen ab. Alle Schüler bejahten die Gesundheitsfrage, woraufhin der Schulleiter die Prüfungsbestimmungen im Hinblick auf Täuschungsversuche verlas. Im Protokoll wurden die Abgabezeiten, Toilettengänge und die Namen der aufsichtführenden Lehrkräfte notiert. Die Korrektur wurde von zwei Fachlerern vorgenommen. Aus den beiden Notenvorschlägen ergab sich die Prüfungsnote.
Die Englischprüfung bestand aus zwei Aufgaben, nämlich einem Diktat zum Thema „Shakespeare“ und der Nacherzählung der Geschichte „Lost and Found“, die beide von der Lehrerin vorgetragen wurden und von den Schülern aufzuschreiben bzw. mit Hilfe eines Lexikons schriftlich nachzuerzählen waren. Prüfungsergebnis: 4 mal 2, 9 mal 3, 11 mal 4, Durchschnitt 3,3.
In der Mathematikprüfung am folgenden Tag, die die meiste Zeit unter der Aufsicht von Herrmann Seidel stand, waren als Hilfsmittel Zeichengeräte, Rechenschieber und eine den Schülern zuvor im Unterricht diktierte Formelsammlung zugelassen. Prüfungsergebnis: 7 mal 2, 7 mal 3, 9 mal 4, 1 mal 5, Durchschnitt: 3,2.
Die Deutschprüfung begann nach dem Austeilen der Papierbögen mit der Auswahl der Aufsatzthemen. Nach einer viertelstündigen Bedenkzeit entschieden sich 18 Prüflinge für das Thema „Die Überwindung des Raumes durch den Menschen“ und die übrigen sechs für „Octavio Piccolomini nach Schillers ‚Wallenstein‘“. Eine Dreiviertelstunde lang weilte auch die Kreisschulrätin Hertha Kleinig im Prüfungsraum, wohl um sich persönlich vom ordnungsgemäßen Ablauf zu überzeugen. Prüfungsergebnis: 10 mal 2, 12 mal 3, 2 mal 4, Durchschnitt: 2,7.
Die Chemieprüfung begann mit der Bekanntgabe der ersten beiden Prüfungsfragen („Welche gasförmigen Elemente kenne ich?“ und „Wie werden sie gewonnen?“), die von 8 bis 9.45 Uhr zu bearbeiten waren. Auf eine zehnminütige Pause folgte die Bekanntgabe der Aufgaben für den zweiten Prüfungsteil, nämlich „3.) Nenne Masse u. Formel der wichtigsten anorganischen Säuren.“, “4.) a. Wie heißen ihre Salze (Sammelbezeichnung)?“ und „b. Nenne einige Beispiele (Name u. Formel)“. Prüfungsergebnis: 4 mal 1, 8 mal 2, 7 mal 3, 3 mal 4, 2 mal 5. Durchschnitt: 2,6.
Die Lateinprüfung legten nur die Hospitantin und der Externe ab – in getrennten Räumen und ohne Hilfsmittel. Sie bestand aus einer Übersetzung von Caesars „De bello Gallico“, Buch 7, Kapitel 11 und Anfang von Kapitel 12. Prüfungsergebnis: 1 mal 3, 1 mal 4, Durchschnitt: 3,5.
Die folgenden PDF-Dateien enthalten die Aufgabenstellungen und jeweils eine bewertete Schülerarbeit (die Namen der Schüler sind geschwärzt).
Die mündlichen Prüfungen (Abteilung A)
Nach einigen Tagen Verschnaufpause begannen die mündlichen Prüfungen im Fach Physik am 19. April mit zwei Teilnehmern und Fragen aus den Gebieten der geometrischen Optik, der Relativitätstheorie und der Atomtheorie. Beide Prüflinge erhielten die Note 3.
Im Fach Erdkunde traten bei Professor Jaronczyk nur die Hospitantin und der Externe an. Sie mussten sich Fragen aus den Gebieten Sonne als Urquell aller Energie, Bestimmung der geografischen Breite und Länge, weiße und blaue Kohle, ökologische Bedingungen für das Pflanzenleben, Höhenmessung, Nordamerika und Asien im Vergleich sowie Europa, Asien, Mäßigung und Großräumigkeit stellen. Beide Prüflinge bestanden mit einer 3 bzw. einer 2.
An der Mathematikprüfung bei Hermann Seidel am 23. April nahm als Gast erneut die Schulrätin Kleinig teil. Ein Schüler erschien nicht zu dieser und allen weiteren Prüfungen, konnte am nächsten Tag aber eine Entschuldigung vorweisen. Sieben weitere mussten in Mathematik nicht antreten, weil ihre Vornoten und die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung übereinstimmten und nicht unter der Note 2 lagen. Alle weiteren Prüflinge mussten sich Fragen aus den folgenden Gebieten unterziehen:
- I Analytische Geometrie: Allgemeine Kreisgleichung, Bedeutung von a und b, Krümmungsradius der Parabel im Schenkel, Bestimmung einer Parabel bei gegenseitiger Hauptlage und gegenseitigem Krümmungsmittelpunkt für den Scheitel, Schnittpunkt zweier Kurven, Bedingung für den Schnitt, analytischer Ausdruck dafür, Bestimmung der Schnittwinkel.
- II Differentialrechnung: Bestimmung günstigster Fälle an stereometrischen Körpern (Volumen = Maximum): Pyramide, Zylinder.
Dr. Truckenbrodt stellte stellte der Abteilung A im Fach Geschichte Fragen zur allgemeinen Geschichtswissenschaft und zur Geschichtsphilosophie, zu bedeutenden Ereignissen des Altertums und des Mittelalters sowie zur Zeit nach 1815.
Zur Deutschprüfung bei Hermann Hallbauer mussten vier Schüler nicht antreten, die übrigen befassten sich mit klassischer Dichtung, Goethe und Schiller sowie Faust, Urfaust und historischem Faust.
In der Lateinprüfung bei Dr. Truckenbrodt hatten sich die Prüflinge der Abteilung A mit der Übersetzung eines Textes aus dem dritten Buch von Caesars „De bello civilii“ zu befassen.
Das Prüfungsgebiet in Biologie bei Gerhard Kunze war der Stoffwechsel bei Tier und Mensch.
Die mündlichen Prüfungen (Abteilung B)
Der zweite Prüfungstag, an dem der am Vortag nicht angetretene Schüler doch noch erschien, begann mit einer Überraschung: Die Mathematikprüfung leitete nicht wie am Tag zuvor Hermann Seidel, sondern die Schulrätin Kleinig. Sie stellte Aufgaben aus den Bereichen Kurvendiskussion, Differentialrechnung und analytische Geometrie. Dr. Truckenbrodt konzentrierte sich in Geschichte auf die Zeit nach 1815 unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Frage und deren Lösung. In Deutsch – drei Schüler mussten nicht geprüft werden – stand bei Hermann Hallbauer erneut klassische Dichtung auf dem Programm, nämlich Schillers Leben, Wallenstein und Goethes Faust. Die beiden Schulfremden wurden eingehender geprüft und mussten sich mit Karl August, Karl Eugen, Schiller in Mannheim und dem Begriff „Epos“ bzw. Hauptmanns Weber und Biberpelz sowie Thomas Manns Buddenbrooks auseinandersetzen. Dr. Truckenbrodt ließ in Latein aus dem ersten Buch des „De bello civilii“ übersetzen, Gerhard Kunze prüfte in Biologie in den Bereichen Hormone, Vitamine, Pflanzenzelle und Bakterien.
Die Ergebnisse
Am 29. April 1947 meldete Oberstudiendirektor Dr. Knopf das Prüfungsergebnis an die Abteilung Volksbildung bei der Landesverwaltung Sachsen in Dresden. Von den 24 Prüflingen hatten vier nicht bestanden, darunter der Externe. Jeweils zehn Schülerinnen und Schüler erhielten das Prädikat „bestanden“ bzw. „gut bestanden“. Dem Schreiben war ein Berufswahlfragebogen beizufügen, aus dem die Pläne der Absolventen hervorgehen: Sechs von ihnen beabsichtigten eine medizinische Laufbahn, jeweils drei nahmen ein Studium der Natur- bzw. der Ingenieurswissenschaften auf und jeweils einer entschied sich für das höhere Lehramt, Philosophie bzw. Geschichtswissenschaft, Volkswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften sowie ein Studium an einer Musik- oder Kunsthochschule. Drei Abiturienten planten eine nichtakademische Laufbahn, zwei von ihnen in einem kaufmännischen Beruf, einer in Landwirtschaft und Gartenbau.